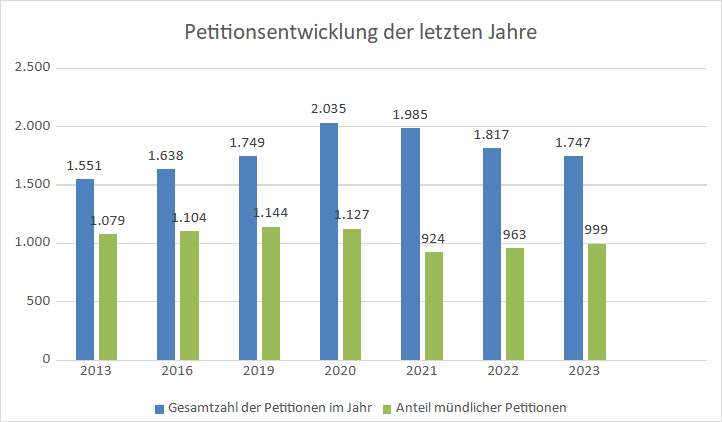Auch Wohnungslose wollen wählen (Fortsetzung aus 2021)
Im Jahresbericht 2021 wurde der Fall eines Bürgers ohne festen Wohnsitz geschildert, der Schwierigkeiten hatte, in das Wählerverzeichnis für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Landtag eingetragen zu werden.
Selbstverständlich haben auch Menschen ohne festen Wohnsitz das Recht, sich an Wahlen zu beteiligen. Da sie nicht im Melderegister und damit auch nicht im Wählerverzeichnis ihrer Gemeinde gelistet sind, müssen sie einen Antrag stellen, um durch Eintragung im Wählerverzeichnis an der Wahl teilnehmen zu können. Für diese Antragstellung müssen Fristen amtlich bekannt gemacht werden. Diese Veröffentlichungen auf herkömmlichem Weg erreichen Menschen ohne festen Wohnsitz aber oft nicht.
Damit wohnungslose Wahlberechtigte künftig generell über die erforderliche rechtzeitige Antragstellung besser informiert werden, schlug der Bürgerbeauftragte den Landkreisen, den kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten vor, über die Voraussetzungen und Fristen für eine Eintragung in das Wählerverzeichnis auch auf anderen Wegen als nur durch amtliche Bekanntmachung zu informieren. Die Wahlbehörden könnten etwa an Einrichtungen herantreten, die üblicherweise Kontakt zu Wohnungslosen haben, wie gemeinnützige Träger der Wohnungslosenhilfe oder private Initiativen (Obdachlosenunterkünfte, Tafeln). Auch die Sozialämter könnten Hinweise und Erklärungen aushängen. Mit einem geringen Mehraufwand würde mehr Bürgern die Teilnahme an Wahlen erleichtert. Die Reaktionen der angeschriebenen Kommunen auf die Vorschläge des Bürgerbeauftragten fielen ganz überwiegend positiv aus. Die Mehrheit der Städte und Landkreise will bei den nächsten Wahlen – dies sind im Jahr 2024 die Europa- und die Kommunalwahl – entsprechende Anstrengungen unternehmen.
Der Bürgerbeauftragte wies das Innenministerium 2023 mit Blick auf die kommenden Wahlen auf praktische Erleichterungen und rechtliche Anpassungsmöglichkeiten hin. Dieses griff diese Vorschläge auf und kündigte an, sie in die Prüfung für die Erarbeitung der Wahl-Verwaltungsvorschrift einzubeziehen bzw. als Empfehlung an die Kommunen weiterzugeben. So sei unter anderem ein Muster für den Antrag, mit dem wohnungslose Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen werden können, entwickelt worden. Dieses Muster soll in die Verwaltungsvorschrift aufgenommen werden, ebenso wie ein Muster für einen Informationsaushang in den oben erwähnten typischen Anlaufstellen für wohnungslose Personen.
Ein Standesamt traut (sich) nicht (Fortsetzung aus dem Vorjahr)
2022 berichtete der Bürgerbeauftragte über einen Fall, bei dem das Standesamt einer Kleinstadt die Eheschließung einer älteren Mitbürgerin verweigert hatte. Begründet hatte das Standesamt die Ablehnung damit, dass zunächst geklärt werden müsse, ob eine vorhergehende Scheidung der Bürgerin im Ausland 2009 oder erst 2012 rechtswirksam erfolgt sei. Der Bürgerbeauftragte hatte vergeblich sowohl das Standesamt als auch die Fachaufsicht beim Landkreis und im Innenministerium darauf hingewiesen, dass kein Ehehindernis bei der Petentin bestehe. Für das Eingehen einer neuen Ehe sei es nämlich unwesentlich, wann genau eine vormalige Ehe rechtswirksam geschieden worden sei, solange – wie im hiesigen Fall – feststehe, dass eine Scheidung jedenfalls erfolgt sei. Zudem war der frühere Ehegatte inzwischen verstorben.
Im Oktober 2022 hatte das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Petentin die Rechtsauffassung des Bürgerbeauftragten bestätigt und angeordnet, dass das Standesamt die Eheschließung vorzunehmen habe. Da dieses aber Rechtsmittel einlegte, musste das Oberlandesgericht entscheiden. Auch dieses stellte im Frühjahr 2023 fest, dass kein Ehehindernis vorliege und das Standesamt unnötige Fragen aufgeworfen habe. Die Eheschließung müsse stattfinden. Daraufhin konnte das ältere Paar im Mai 2023 endlich heiraten – fast zwei Jahre nach der Bestellung des Aufgebots.
Zur Nachbearbeitung des Vorgangs wandte sich der Bürgerbeauftragte erneut an Landkreis und Innenministerium. Er kritisierte, dass die Fachaufsichten die wesentlichen Kernpunkte des Problems nicht erkannt hatten.
Der Landkreis, dessen Fachaufsicht mit einer Stellungnahme die Probleme ursprünglich ausgelöst hatte, zog sich nun darauf zurück, dass man nur eine beratende Funktion gehabt habe. Das Problem sei durch das Standesamt verursacht worden. Man habe nach einer praktikablen Lösung gesucht, aber der zuständigen Mitarbeiterin des Landkreises habe letztlich der „Mut“ gefehlt, eine solche dem Standesamt vorzuschlagen. In künftigen Fällen wolle man „mutiger“ sein.
Das Innenministerium machte es sich noch einfacher. Es verwies zum einen darauf, dass die Standesbeamten nach dem Personenstandsgesetz unabhängig seien. Zum anderen habe es zwar unterschiedliche Rechtsauffassungen gegeben, aber es sei keine offenkundig abwegige Rechtsauslegung zu erkennen gewesen. Es habe daher keine weiteren Argumente gegeben, um das Standesamt zu einem Umdenken zu bewegen.
Der Bürgerbeauftragte bleibt dabei, dass seitens der Fachaufsichten die Sach- und Rechtslage unzureichend geprüft und das Standesamt unzulänglich beraten wurde. Zwar sind Standesbeamte gemäß § 2 des Personenstandsgesetzes nicht an Weisungen gebunden. Die Fachaufsicht hat jedoch auch in diesem Fall die Aufgabe, auf eine fehlerfreie Rechtsanwendung hinzuwirken. Hätten die Fachaufsichten die Standesbeamtin deutlich genug auf die offenkundige Rechtslage hingewiesen, hätte diese wohl die Eheschließung durchgeführt. So musste sie gerichtlich dazu gebracht werden.
Weiterhin: Probleme bei der Terminvergabe von Behörden
Auch in diesem Berichtsjahr beschwerten sich wiederholt Bürgerinnen und Bürger, dass es unmöglich sei, bei bestimmten Behörden zeitnah Termine zu erhalten. Zwei Beispiele:
- Ein Ehepaar berichtete, dass es für seine Tochter kurzfristig einen Kinderreisepass benötigt hatte. Bei einer Anfrage im Februar habe die zuständige Amtsverwaltung ihnen allerdings nur einen Termin für Mai angeboten. Alternativ könnten sie an einem bestimmten Wochentag nachmittags auch ohne Termin vorbeikommen. Vor Ort seien sie jedoch abgewiesen worden, da es an diesem Nachmittag keine Kapazitäten gegeben habe. Ein erneuter Termin sei dann erst für Juni angeboten worden. Letztlich sei es den Petenten nur mit „viel Bitten und Betteln“ gelungen, bei einer anderen Sprechzeit doch noch kurzfristig einen Ausweis zu erhalten, aber nur, weil ein anderer Bürger kurzfristig seinen Termin abgesagt hatte.
- In einem anderen Fall berichtete ein Bürger, dass er Anfang Juni für seine drei Kinder Reisepässe für eine ab 22. Juli anstehende Reise beantragen wollte. Der früheste online erhältliche Termin beim Bürgerbüro sei jedoch erst nach Reisebeginn gewesen. Eine Mitarbeiterin vor Ort habe ihm keinen früheren Termin geben können. Auch bei einer persönlichen Vorsprache mit seinen Kindern während der terminfreien Öffnungszeiten sei es ihm nicht möglich gewesen, die Pässe zu beantragen. Man habe ihm gesagt, dass es nicht das Problem des Bürgerbüros sei, wenn er seine Reise nicht früh genug plane. Er könne es ja erneut bei einem anderen Sprechtag versuchen, aber immer nur mit einem der drei Kinder.
Für den Bürger, der für die Behördentermine jedes Mal freinehmen musste, war dies keine Lösung. Nachdem er erfahren hatte, dass in Ausnahmefällen auch örtlich unzuständige Behörden Ausweise ausstellen können, erkundigte er sich bei anderen Meldebehörden des Umlandes. Bei einer anderen Amtsverwaltung konnte er dann unproblematisch Ausweise erhalten. Dafür hatte ihm die zuständige Mitarbeiterin kurzfristig und sogar außerhalb der Sprechzeiten einen Termin ermöglicht.
Der Bürgerbeauftragte wertete diese Fälle mit den zuständigen Behörden aus. Von Seiten der Behördenleitungen wurden die Probleme aber eher bagatellisiert. Im ersten Fall versprachen sie Verbesserungen, um schnellere Terminvergaben zu erreichen. Dies erfolgte dann auch bis zum Jahresende. Im zweiten Fall wurden die Probleme weitgehend bestritten.
Bei Internetrecherchen musste der Bürgerbeauftragte bei Behörden im ganzen Land immer noch feststellen, dass Termine teilweise erst mit langen Wartezeiten vergeben werden. Weiterhin ist es dem Bürgerbeauftragten daher ein wichtiges Anliegen, eine gute Zugänglichkeit von Behörden zu sichern. Bürger sollen in allen Behörden die Möglichkeit haben, zu allgemeinen Öffnungszeiten ohne Termin vorzusprechen – auch wenn es dann zu Wartezeiten kommen kann. Daneben können und sollten auch individuelle Terminabsprachen online oder telefonisch angeboten werden. Bei kurzfristig entstandenen Problemen – wie den oben geschilderten Fällen – muss es möglich sein, auch kurzfristig Lösungen zu finden. Der gute Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen ist grundlegend für ein solides Vertrauen in die öffentliche Verwaltung. Hierzu gaben die Bürgerbeauftragten der Länder eine gemeinsame „Schweriner Erklärung“ im April 2023 ab (vgl. C.).
Gemeindliche Finanzlage verhindert Lösungen
Gesetzliches Ziel der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten ist u. a. die schnelle und einvernehmliche Lösung von Streitigkeiten zwischen Bürgern und Staat (§ 7 PetBüG M-V). Manchmal scheitern Lösungen sogar trotz jahrelanger Bemühungen des Bürgerbeauftragten an der Finanzlage und letztlich auch an dem politischen Willen der beteiligten Kommunen. Hierzu zwei Beispiele:
- In einem Fall hatte sich schon 2018 ein Bewohner einer dörflichen Gemeinde an den Bürgerbeauftragten gewandt. Er beklagte Probleme mit der Regenentwässerung seiner Wohnstraße. Ursprünglich war das Niederschlagswasser der Straße auf einem Nachbargrundstück des Petenten entsorgt worden. Nach Grundstücksverkauf und Bebauung setzte die Gemeinde als Ersatz Versickerungsschächte für das Regenwasser, die aber bei starkem Regen nicht ausreichen. In einem Fall kam es dazu, dass Regenwasser über die Garagenzufahrt in das Haus des Petenten eindrang und erhebliche Schäden anrichtete. Auch bei anderen Regenfällen staute sich das Wasser seenartig vor dem Grundstück des Petenten. Nur weil er inzwischen seine Garageneinfahrt mit einer Holzkonstruktion verbarrikadiert hatte, kam es in der Folge nicht mehr zu größeren Schäden.
Seit Einreichen der Petition bemühte sich der Bürgerbeauftragte wiederholt und intensiv um eine Lösung. Ursprünglich von der Gemeinde zugesagte Bauarbeiten zur Verbesserung der Entwässerung fanden nie statt. Auf weitere Nachfragen und Gespräche des Bürgerbeauftragten wurden wiederholt Prüfungen für eine Lösung und Verbesserungsarbeiten in Aussicht gestellt. Tatsächlich erfolgten aber unter Hinweis auf die mangelnde Finanzierbarkeit für die finanziell angeschlagene Gemeinde über Jahre keine Maßnahmen.
Der Petent hatte für den größeren Wassereintritt in seinem Haus inzwischen eine Klage auf Schadensersatz gegen die Gemeinde eingereicht. Nachdem diese Klage 2023 aus formalen Gründen abgewiesen worden war, sah die Gemeinde plötzlich keine Notwendigkeit mehr, die Straßenentwässerung zu verbessern, obwohl die Problematik offenkundig weiter besteht. Der Bürgerbeauftragte hat die Angelegenheit aufbereitet und an den Petitionsausschuss des Landtages abgegeben, da er es nicht hinnehmen will, dass sich die Gemeinde unter Verweis auf ihre Finanzlage ihrer Pflicht zur ordnungsgemäßen Entwässerung entzieht.
- In einem anderen Fall hatte ein Bürger 2019 eine Petition eingelegt. Über sein landwirtschaftliches Grundstück war während der DDR-Zeit ein öffentlicher Weg angelegt worden, der inzwischen als touristischer Radweg genutzt wird. Der Eigentümer wollte diese Fläche mit ihren Lasten an die Gemeinde abgeben. Für solche Fälle bestimmt das Verkehrsflächenbereinigungsgesetz eine Verpflichtung der Gemeinde zum Kauf der öffentlichen Wegfläche auf Antrag des Grundeigentümers. Der Petent hatte hierzu bei der Gemeinde nachgefragt – ohne Ergebnis. Letztlich sah die Gemeinde nach wiederholtem Nachhaken des Bürgerbeauftragten ein, dass sie die Fläche übernehmen muss. Das wesentliche Problem ist für die sehr kleine Gemeinde (unter 150 Einwohner) aber die Finanzierung der Vermessungskosten. Der zuständige Dezernent des Landkreises hatte zwischenzeitlich dem Bürgerbeauftragten zugesagt, zur Unterstützung der Gemeinde die Vermessung durch das Katasteramt selbst durchführen zu lassen, so dass keine Kosten für externe Vermesser anfielen. Die Gemeinde entschied sich zuletzt aber dafür, aus Kostengründen ein Bodenordnungsverfahren einleiten zu lassen. Denn in einem solchen Verfahren werden Grundstückszuordnungen und Vermessungen durch die Bodenordnungsbehörde durchgeführt. Damit wollten sich der Petent und der Bürgerbeauftragte aber nicht zufriedengeben, da solche Verfahren viele Jahre dauern können. Der Bürgerbeauftragte forderte die Gemeinde erneut auf, den Weg zu übernehmen – so wie es das Gesetz auch vorsieht. Entnervt über die lange Verfahrensdauer verkaufte der Petent letztlich das Grundstück. Damit war die Petition abgeschlossen, nicht unbedingt aber auch das Problem gelöst.
Beide Fälle zeigen, dass kleinere Gemeinden schon durch überschaubare finanzielle Aufwendungen überfordert sein können. Das aber entbindet sie nicht von der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Dann stellt sich die Frage, ob sie strukturell und funktionell leistungs- und lebensfähig sind. Zu prüfen ist hier immer auch, ob nicht Sonderbedarfszuweisungen beantragt werden können.
Gemeindevertretung: Eingeschränktes Fragerecht?
Vermehrt erreichten den Bürgerbeauftragten Eingaben von Bürgern, weil sie ihr Einwohnerfragerecht in den Gemeindevertretersitzungen nur beschränkt ausüben können.
Die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern sieht die Möglichkeit der Einwohner vor, in den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung zu Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft Fragen zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Kommunalverfassung überlässt es jedoch den Gemeinden, nähere Regelungen hierzu in ihrer Hauptsatzung zu treffen. Häufig enthalten diese Satzungen ein eingeschränktes Fragerecht: Fragen und Anregungen der Einwohner dürfen keinen Bezug zu den Beratungsgegenständen der aktuellen Sitzung haben.
Begründet wird diese Einschränkung häufig damit, dass die Gemeindevertreter unabhängig von der anwesenden Öffentlichkeit ihre Beratung führen können und die Beratungsgegenstände nur einmal pro Sitzung behandelt werden sollen. Die Beschlussvorlage der Verwaltung bzw. die Vorbereitung in den Ausschüssen müssten Ausgangspunkt der Diskussion in der Gemeindevertretung sein und nicht die Fragen und Standpunkte der Betroffenen, die durch ihr Auftreten die Gemeindevertreter beeinflussen könnten.
Der Bürgerbeauftragte wandte sich an den Innenminister. Dieser erklärte, dass die Kommunalverfassung zwar nicht verbiete, in der Fragestunde auch Beratungsgegenstände zu erörtern, die auf der Tagesordnung der Sitzung stünden. Eine Einschränkung in den Hauptsatzungen der Gemeinden sei jedoch zulässig. Dies habe das Innenministerium bereits 2013 in einem Runderlass klargestellt. Die Regelungen in den jeweiligen Hauptsatzungen der Gemeinden seien wohl auf die Mustersatzung des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern zurückzuführen. Dabei sei unklar, ob die Kommune tatsächlich ein Bedürfnis zur Beschränkung des Fragerechts der Einwohner habe oder ob die Regelung des Hauptsatzungsmusters nur einfach übernommen worden sei.
Der Minister sehe im Ergebnis keinen Anlass für eine Änderung der Kommunalverfassung. Es könne von den Kommunen vor Ort am besten entschieden werden, ob in der Fragestunde im Interesse einer größtmöglichen Bürgerbeteiligung auch Fragen zu den tagesaktuellen Beratungsgegenständen zugelassen werden könnten oder aber der Schutz des Meinungsbildungsprozesses dies ausschließe.
Der Bürgerbeauftragte kann den Wunsch der Bürger nach mehr Bürgerbeteiligung nachvollziehen. Er hält es daher nicht für überzeugend, dass aktuelle Beratungsgegenstände nicht auch Gegenstand der – ohnehin zeitlich limitierten – Einwohnerfragestunden sein dürfen. Zwar mag die Regelung in der Hauptsatzung rechtlich nicht zu beanstanden sein. Es ist aber lebensfremd, dass vom Bürger aufgrund der Tagesordnung aufgeworfene aktuelle Fragen nicht oder erst in anderen Gemeindevertretersitzungen angesprochen werden können. Daher setzt sich der Bürgerbeauftragte weiterhin für eine Öffnung der Gemeindevertretungen zu mehr Bürgernähe ein. Dies wird in einigen Städten und Gemeinden bereits in den jeweiligen Hauptsatzungen umgesetzt.
Sprachkenntnisse bei der Einbürgerung
Die Ausländerbehörden müssen inzwischen vermehrt über Einbürgerungsanträge entscheiden, wenn ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger bei erfolgreicher Integration die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten wollen. Hierfür sollen mündliche und schriftliche deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau B 1 nachgewiesen werden. Dies kann gerade bei den schriftlichen Kenntnissen mitunter aber nicht sachgerecht und zweckmäßig sein:
- In einem Fall ging es um die kambodschanische Lebensgefährtin eines Deutschen. Diese hatte 2016 einen Deutschkurs mit dem niedrigeren Niveau A 2 bei der schriftlichen Prüfung absolviert. Danach absolvierte sie noch die 9. und 10. Klasse an einer Volkshochschule. Dies sollte nach Ansicht der Einbürgerungsbehörde eines Landkreises aber nicht für den Nachweis der schriftlichen Sprachkenntnisse ausreichen.
Der Bürgerbeauftragte wies die Behörde darauf hin, dass nach Anwendungshinweisen des Bundesministeriums des Innern die Sprachkenntnisse in der Regel schon nachgewiesen sind, wenn eine Versetzung in die 10. Klasse erfolgt ist. Daraufhin lud die Einbürgerungsbehörde die Petentin zu einem Gespräch ein und konnte sich hierbei von den Sprachkenntnissen ohne weitere schriftliche Prüfung überzeugen.
- Eine andere Petition betraf eine ältere bosnische Bürgerin, die sich schon über 30 Jahre in Deutschland aufhielt. Ihr Ehemann und sie führten seit Jahren im Mecklenburg-Vorpommern ein eigenes Restaurant. Die Frau hatte durch den Geschäfts- und Kundenkontakt sehr gute Sprachkenntnisse im Bereich Hören, Lesen und Sprechen; nur beim Schriftlichen haperte es: Hier konnte sie nur die Stufe A 1 vorweisen. Ihr Ehemann und die gemeinsamen Kinder waren bereits länger eingebürgert. Der Landkreis hatte daher das Innenministerium als oberste Ausländerbehörde um eine Ausnahmeerlaubnis gebeten, die Frau dennoch im Rahmen des Ermessens einbürgern zu dürfen. Dies wollte das Innenministerium ablehnen, da sie keine Bemühungen für den Spracherwerb vorgetragen habe.
Der Bürgerbeauftragte, dem das Anliegen bei einem Sprechtag vorgetragen wurde, bat das Ministerium, seine Haltung zu überdenken. Er verwies hierbei auf die Erwerbsbiographie der Petentin und die Doppelbelastung durch Geschäftsbetrieb und Kindererziehung. Es sei nachvollziehbar, dass daneben der Erwerb der Schriftsprache in Kursen schwierig sei. Mündlich beherrsche sie die Sprache ja sehr gut. Die Petentin sei auch bereits 63 Jahre alt. Ab einem Alter von 67 Jahren könne man ohnehin eine Einbürgerung auch bei mangelnden Sprachkenntnissen durchführen.
Daraufhin stimmte das Ministerium unter Berücksichtigung der Umstände in diesem Einzelfall der Einbürgerung zu.
Diese Fälle zeigen, dass im Ermessenswege durchaus Möglichkeiten bestehen, gut integrierten ausländischen Mitbürgern die Einbürgerung zu ermöglichen, auch wenn die eigentlich notwendigen schriftlichen Sprachkenntnisse nicht vollständig vorliegen oder nachgewiesen werden.
Kurabgabenermäßigung bei Behinderungen
Gehäuft beklagten Petenten, dass Kur- und Erholungsorte in ihren Satzungen keine Ermäßigung oder Befreiung mehr für Menschen mit Behinderungen oder notwendige Begleitpersonen (z. B. bei Merkzeichen B, H) vorsehen.
Das Kommunalabgabengesetz (KAG) sieht die Möglichkeit der vollständigen oder teilweisen Befreiung vor. Innerhalb der gesetzlichen Vorgaben sind die Gemeinden in der Ausgestaltung der Satzung frei. Sie können eine Befreiung vorsehen. Die Verwaltungsvorschrift empfiehlt dies sogar.
Allerdings antwortete die vom Bürgerbeauftragten angefragte Landesregierung, nicht aufsichtlich eingreifen zu können. Auf die Bitte des Bürgerbeauftragten, jedenfalls bei öffentlichen Förderungen von Kureinrichtungen die Bewilligung von der Barrierefreiheit der Kurangebote abhängig zu machen, erwiderte der zuständige Minister, schon aus baurechtlichen Gründen könne es eine umfassende und vollständige Barrierefreiheit praktisch nicht geben, wobei jedoch eine möglichst barrierearme Umgebung das Ziel sei.
Der Bürgerbeauftragte regte im Inklusionsförderrat an, dass dieser die Kurgemeinden um entsprechende Befreiungs-/Ermäßigungsregeln bittet oder den Landtag als Gesetzgeber um eine Gesetzesänderung ersucht. Der Bürgerbeauftragte ist der Auffassung, dass im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention Ermäßigungen bei den Kurabgaben als Nachteilsausgleich zwingend sind. Das gilt erst recht, seitdem nach einer Gesetzesänderung auch verstärkt Erholungsorte eine Kurabgabe erheben. Der Inklusionsförderrat forderte in der Folge die Landesregierung auf, die Initiative zu einer Anpassung des KAG zu ergreifen. Die Landesregierung lehnte dies ab, weshalb der Bürgerbeauftragte die Angelegenheit an den Petitionsausschuss abgab.
Ordnungsrecht: Parken an Engstelle
Wer eine Verwarnung wegen eines Parkverstoßes erhält, freut sich nie. Ärgerlich wird es aber, wenn „Parksünder“ nicht erkennen können, was ihnen vorgeworfen wird. Zum Beispiel, wenn sie zuvor jahrelang unbeanstandet an dieser Stelle geparkt hatten. So in dem folgenden Fall:
- Ein Paar parkte seit Jahren seine beiden Fahrzeuge in seiner innerstädtischen Wohnstraße – wie viele andere Anwohner auch. Parkbeschränkungen waren dort nicht angeordnet. An einem Freitagnachmittag fanden sie aber an einem ihrer dort geparkten Fahrzeuge einen Hinweis auf eine kostenpflichtige Verwarnung vor. Da es sich nach der Annahme der Bürger nur um einen Irrtum handeln konnte, wollten sie dies gleich am Montagmorgen mit dem Ordnungsamt telefonisch klären. Bevor sie dieses aber erreichen konnten, erhielten sie schon weitere Verwarnungen, diesmal für beide Fahrzeuge. Auch viele andere Anwohner fanden entsprechende „Strafzettel“ an ihren Fahrzeugen.
Auf ihre Nachfrage beim Ordnungsamt erfuhren die Bürger, dass es Schwierigkeiten bei der Durchfahrt von Müllfahrzeugen gegeben habe. Deswegen habe das Ordnungsamt die Straße vermessen und festgestellt, dass durch das Parken nicht die erforderliche Mindest-Durchfahrtsbreite von 3,05 Metern vorhanden sei. Das Ordnungsamt gab an, zunächst kostenfreie Verwarnzettel an den dort parkenden Fahrzeugen befestigt zu haben, bevor es dann auch kostenpflichtige Verwarnungen ausstellte. Die Bürger hatten davon aber nichts mitbekommen. Das Ordnungsamt teilte ferner mit, dass in der Straße auch bald Parkverbotsschilder aufgestellt werden sollten. Das Verwarngeld müsse auf jeden Fall bezahlt werden.
Empört meldete sich das Paar beim Bürgerbeauftragten. Dieser bat das Ordnungsamt um Aussetzung der laufenden Verfahren zur Vermeidung kostenpflichtiger weiterer Schritte und die Verwaltungsspitze um eine Prüfung der Vorgehensweise. Es sei offenbar für viele Anwohner nicht erkennbar gewesen, dass die Straße zu schmal sei, zumal sie dort zuvor jahrelang unbeanstandet geparkt hätten. Es sei auch unverständlich, warum man erst Verwarnungen verteile und anschließend Parkverbotsschilder aufstelle.
Vom Ordnungsamt erhielt daraufhin der zuständige Mitarbeiter des Bürgerbeauftragten einen Anruf. „Selbstverständlich“, so eine höhere Mitarbeiterin, werde man die Verfahren nicht aussetzen. Es stünde den Bürgern ja frei, die Verwarnungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Die Hinweise des Mitarbeiters des Bürgerbeauftragten, dass eine solche Verfahrensweise bei ähnlichen Fällen in anderen Kommunen unproblematisch möglich sei, fruchteten nicht.
Erst nach wiederholten, energischen Schreiben des Bürgerbeauftragten an die Verwaltungsleitung zeigte die Stadt Einsicht. Der zuständige Beigeordnete räumte ein, dass sich die Petenten beim Abstellen ihrer Fahrzeuge offenbar „in einem nicht vorwerfbaren Verbotsirrtum“ befunden hätten. Die Verfahren wurden eingestellt, soweit sie nicht durch eine Zahlung der Betroffenen bereits abgeschlossen waren.
Während der Bearbeitung der Petition wurde dann auch in der Straße ein Verkehrszeichen für ein Parkverbot aufgestellt, allerdings nur von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr. Bürgernäher als ein komplettes Parkverbot ist diese Lösung immerhin.
Keine Erstattung der Gebühr für den Anwohnerparkausweis
Mit einem ganz anderen Problem hatte sich eine Bürgerin derselben Stadt im Mai 2023 beim Bürgerbeauftragten gemeldet. Sie hatte schon im März 2022 einen Anwohnerparkausweis beantragt und für die Ausstellung vorab die Gebühr entrichtet. Der Antrag wurde allerdings im Mai 2022 abgelehnt. Auch der hiergegen eingelegte Widerspruch der Bürgerin wurde im Dezember 2022 zurückgewiesen. Die gezahlte Gebühr hatte die Petentin aber trotz wiederholter Bemühungen nicht erstattet bekommen. Vergleichbare Schwierigkeiten gab es offenbar auch bei anderen Bürgern.
Daraufhin bat der Bürgerbeauftragte die Stadtverwaltung um Überprüfung und Stellungnahme. Ende Juli 2023 wurde der Petentin endlich die Gebühr zurückgezahlt. In einer Stellungnahme räumte die Verwaltung ein, dass die zuständige städtische Behörde „in Teilen derzeit nicht zufriedenstellend funktioniert“. Man arbeite intern an einer Lösung, die zeitnah umgesetzt werden solle. Gegen Ende des Jahres berichtete die Stadt dann, dass inzwischen bei Ablehnungen die gezahlten Gebühren kurzfristig erstattet würden.
Bauangelegenheiten
Im Baurecht gibt es viele Konstellationen, in denen Bürger mit der Verwaltung im Streit liegen können. Beim Bürgerbeauftragten beschweren sich Bürger beispielsweise über die Verweigerung von Baugenehmigungen oder auf der anderen Seite über erteilte Baugenehmigungen für Nachbarn, bei denen sie ihre Rechte verletzt sehen. Auch die Durchsetzung der Bauordnung ist ein wiederkehrendes Thema.
Häufig beklagen sich Bürger beim Bürgerbeauftragten über die langen Verfahrenslaufzeiten bei Baugenehmigungsverfahren, insbesondere wenn wiederholt Unterlagen nachgefordert werden. Lange Verfahrensdauern können aber durchaus vermieden werden, wenn von Seiten der unteren Baubehörden ein wenig mehr Transparenz und Gesprächsbereitschaft gezeigt wird. Häufig sind nur kleine Hinweise und Erklärungen notwendig, damit die Bürger das Verwaltungsverfahren auch nachvollziehen können.
Genehmigung von Photovoltaik-Anlagen
Schon 2022 berichtete der Bürgerbeauftragte vom Wunsch mancher Bürger nach einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auf dem eigenen Hausdach, der auf oder in der Nähe von Denkmalen regelmäßig am Widerstand der Denkmalschutzbehörde scheiterte. Diese hat den Denkmalschutz gegen den Erhalt der natürlichen Grundlagen – beides öffentliche Belange – abzuwägen. Ebenfalls im Vorjahresbericht war bereits die Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes erwähnt worden, durch die der Bundesgesetzgeber festgelegt hatte, dass der Bau und Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien im überwiegenden öffentlichen Interesse liegen. Der Bürgerbeauftragte kritisierte, dass dies in der Genehmigungspraxis nicht immer berücksichtigt werde.
Im laufenden Berichtsjahr entschied das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern in einem Windkraft-Fall, dass der Bund, obwohl für Denkmalschutz unzuständig, hiermit auch eine im Denkmalschutz verbindliche Festlegung zur Abwägung vornehmen konnte. Das Abwägungsergebnis sei bundesgesetzlich „voreingestellt“, sowohl aus Gründen der Versorgungssicherheit als auch des Klimaschutzes. Nur in atypischen Ausnahmefällen könne sich der Denkmalschutz gegen das überragende Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien durchsetzen. Im gerichtlich entschiedenen Fall wurde ein solch atypischer Ausnahmefall nicht gesehen und das Vorhaben der Windkraftnutzung bestätigt.
Auf diese neue Rechtsprechung machte der Bürgerbeauftragte einen Landkreis, der einem Petenten eine Ablehnung für eine PV-Anlage erteilt hatte, aufmerksam. Ohne Zögern kündigte der Landkreis an, eine Neubewertung vorzunehmen. Eine Bewilligung mit Auflagen wurde erteilt.
In anderen Fällen standen der Errichtung von PV-Anlagen auf Privatdächern, vor allem in Altstädten, städtische Sanierungs- oder Gestaltungssatzungen entgegen. So auch im Fall einer Bürgerin, die ein Haus in der zweiten Reihe im Sanierungsgebiet einer Stadt besitzt. Ihr Grundstück ist von Bebauung umgeben. Das Dach kann man nur in einer bestimmten Sichtachse vom öffentlichen Park aus sehen.
Nachdem mit der Montage der PV-Anlage begonnen wurde, verfügte die Stadt einen Baustopp, weil es keine Genehmigung gab. Daraufhin beantragte die Bürgerin eine Genehmigung, welche aber versagt wurde. Laut Sanierungssatzung soll eine PV-Anlage nur erlaubt sein, wenn sie nicht von der Straße oder öffentlichen Plätzen aus einsehbar ist.
Der um Hilfe gebetene Bürgerbeauftragte wandte sich mit dem Hinweis auf die neue Rechtslage zu Gunsten der Energiegewinnung an den Bürgermeister. Er fragte nach Anpassung der Sanierungssatzung. Der Bürgermeister wies in seiner Antwort darauf hin, dass sich eine Änderung der Satzung bereits in der Erarbeitung befinde. Es seien Lockerungen für den Bau von PV-Anlagen im Sanierungsgebiet vorgesehen.
Der Bürgerbeauftragte empfahl der Petentin, den Beschluss zur Änderung der Gestaltungssatzung abzuwarten und dann einen neuen Bauantrag zu stellen. Nachdem die Satzung geändert worden war, konnte die Petentin die Anlage schließlich montieren lassen.